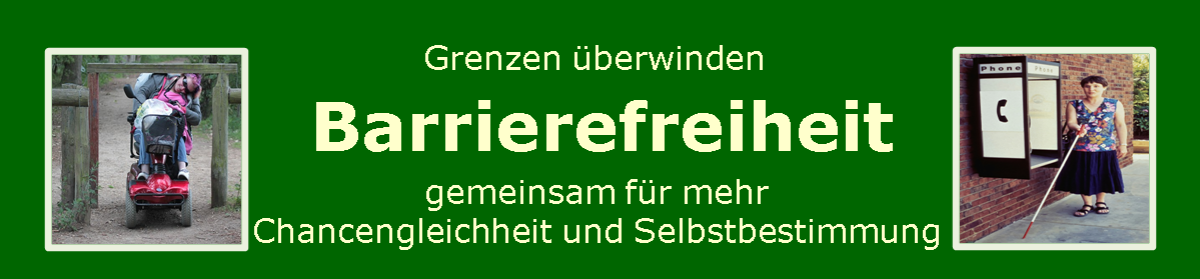Inhalt des Artikels
- 1 Was ist die TSI-PRM?
- 2 Ziele der TSI-PRM
- 3 Kommentierung der TSI-PRM
- 3.1 zu 2.1. Anwendungsbereich der Teilsysteme
- 3.2 zu 2.2. Bestimmung des Begriffs „Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität“
- 3.3 zu 2.3. Sonstige Begriffsbestimmungen
- 3.4 zu 4.2.1. Teilsystem „Infrastruktur“
- 3.5 zu 4.2.1.2. Hindernisfreie Wege (1)
- 3.6 zu 4.2.1.2. Hindernisfreie Wege (2)
- 3.7 zu 4.2.1.2.2. Vertikale Erschließung (2b)
- 3.8 zu 4.2.1.2.2. Vertikale Erschließung (4)
- 3.9 zu 4.2.1.2.3. Kennzeichnung der Wege
- 3.10 zu 4.2.1.2.3. Kennzeichnung der Wege (3)
- 3.11 zu 4.2.1.2.3. Kennzeichnung der Wege (4)
- 3.12 zu 4.2.1.4. Fußbodenoberflächen
- 3.13 zu 4.2.1.5. Kennzeichnung transparenter Hindernisse
- 3.14 zu 4.2.1.8. Fahrkartenschalter, Informations- und Kundenbetreuungsschalter
- 3.15 zu 4.2.1.9. Beleuchtung
- 3.16 zu 4.2.1.10. Visuelle Informationen: Wegweiser, Piktogramme, gedruckte oder dynamische Informationen (4)
- 3.17 zu 4.2.1.10. Visuelle Informationen: Wegweiser, Piktogramme, gedruckte oder dynamische Informationen (7)
- 3.18 zu 4.2.1.10. Visuelle Informationen: Wegweiser, Piktogramme, gedruckte oder dynamische Informationen (14)
- 3.19 zu 4.2.1.13. Bahnsteigende (1)
- 3.20 zu 4.2.1.15. Schienengleiche Bahnübergänge in Bahnhöfen (2)
- 3.21 zu 4.2.1.15. Schienengleiche Bahnübergänge in Bahnhöfen (3)
- 3.22 zu 4.2.2. Teilsystem „Fahrzeuge“
- 3.23 zu 4.2.2.1.2.1. Allgemeines
- 3.24 zu 4.2.2.3.3. Innentüren (6)
- 3.25 zu 4.2.2.4. Beleuchtung
- 3.26 zu 4.2.2.7.4. Dynamische akustische Informationen
- 3.27 zu 4.2.2.7.2. Zeichen, Piktogramme und taktile Informationen (8)
- 3.28 zu 4.2.2.7.3. Dynamische visuelle Informationen (1)
- 3.29 zu 4.2.2.7.3. Dynamische visuelle Informationen (2)
- 3.30 zu 4.2.2.7.3. Dynamische visuelle Informationen (11)
- 3.31 zu 4.2.2.7.4. Dynamische akustische Informationen
- 3.32 zu 4.2.2.8. Niveauwechsel (2)
- 3.33 zu 4.2.2.9. Haltestangen (4)
- 3.34 zu 4.2.2.9. Haltestangen (5)
- 3.35 zu 4.4. Betriebliche Regelungen
- 3.36 zu 4.4.1. Teilsystem „Infrastruktur“
- 3.37 zu 4.4.2.10. Visuelle und akustische Informationen — Werbebeschränkung
- 3.38 zu 4.4.2.15. Hilfeleistung beim Ein- und Aussteigen
- 3.39 zu 5.3.2.1. Bedienelemente von Türen
- 3.40 zu 5.3.2.2. Standard- und Universaltoiletten: Gemeinsame Parameter
- 3.41 zu 5.3.2.2. Standard- und Universaltoiletten: Gemeinsame Parameter (2)
Was ist die TSI-PRM?
Die TSI-PRM (= Technische Spezifikation für die Interoperabilität für Menschen mit Behinderung und Menschen mit eingeschränkter Mobilität) ist ein verbindliches Regelwerk, das im europäischen Eisenbahnsystem zur Anwendung kommt. Sie ist Teil der technischen Vorschriften, die sicherstellen sollen, dass die Produkte für die Infrastruktur und die Fahrzeuge, welche von verschiedenen europäischen Anbietern hergestellt werden, im gesamten europäischen Eisenbahnsystem zuverlässig ausgetauscht und eingesetzt werden können (Interoperabilität).
Ziele der TSI-PRM
Hauptanliegen der TSI-PRM ist die Förderung einer inklusiven Eisenbahninfrastruktur sowie deren Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit für alle Fahrgäste in ganz Europa.
Mit den in der TSI-PRM festgehaltenen spezifischen Anforderungen sollen insbesondere die nachstehenden Ziele erreicht werden.
👉🏻 Sicherstellung der Barrierefreiheit
Die TSI-PRM zielt darauf ab, allen Personen, unabhängig von ihrer körperlichen Verfassung, Behinderungen oder besonderen Bedürfnissen, den Zugang zu Eisenbahndiensten zu ermöglichen.
👉🏻 Förderung von Inklusion und Mobilität
Durch die Umsetzung der TSI-PRM soll die Teilnahme von Menschen mit eingeschränkter Mobilität und von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben verbessert und ihre selbstbestimmte Mobilität unterstützt werden.
👉🏻 Schaffung harmonisierter Standards
Die TSI-PRM soll durch harmonisierte Standards sicherstellen, dass die Anforderungen an ein barrierefreies Eisenbahnsystem in ganz Europa einheitlich umgesetzt wird, was insbesondere für den grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr wichtig ist.
👉🏻 Erleichterung von Planung und Umsetzung
Die TSI-PRM hilft Infrastrukturbetreibern und Eisenbahnunternehmen, Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit in einer strukturierten und normierten Weise umzusetzen. Dies betrifft z. B. die Gestaltung von Bahnsteigen, Zügen, Fahrgastinformationen und Services.
👉🏻 Erfüllung rechtlicher Anforderungen
Die TSI-PRM dient als Grundlage für die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Interoperabilität des Eisenbahnsystems und der Antidiskriminierungsgesetzgebung.
Kommentierung der TSI-PRM
Schienenersatzverkehr Der Schienenersatzverkehr gehört zwar nicht unmittelbar zu dem Teilsystem „Fahrzeuge“ und nur bedingt zum Teilsystem „Infrastruktur“, spielt leider jedoch oftmals eine entscheidende Rolle bei Reisen mit der Bahn. Für mobilitätsbeeinträchtigte Menschen ist dieser, in der Regel aufgrund bestehender Barrieren, nicht nutzbar. Für die Betroffenen bedeutet dies, entweder unverhältnismäßige Umwege in Kauf zu nehmen oder einen freiwilligen Reiseverzicht. So bedarf es auch in der TSI-PRM Ansätze und Lösungen, die eine barrierefreie Nutzung, sowohl eines spontanen als auch eines geplanten Schienenersatzverkehrs, ermöglichen. Den Mitarbeitern der zuständigen Gremien zur Überarbeitung der TSI-PRM sollte dieses Thema bewusst sein und sie werden gebeten, entsprechend praktikable Lösungen in das Regelwerk aufzunehmen. Begriffsbestimmung: blinde und sehbehinderte Menschen zu „Taktilen Zeichen“ „Taktile Zeichen“ und „taktile Bedienelemente“ 👉🏻 Ergänzungsvorschlag: „Taktile Zeichen“ und „taktile Bedienelemente“ Die taktile Wahrnehmbarkeit von Piktogrammen für blinde Menschen wird oftmals überschätzt, da komplexe Symbolgestaltungen von blinden Menschen vielfach nicht erkannt oder nicht richtig interpretiert werden können. Akustische Informationen 👉🏻 Ergänzungsvorschlag: Es wird empfohlen in die TSI-PRM einen weiteren Abschnitt im das Kapitel 4.2.1. Teilsystem „Infrastruktur“ aufzunehmen. Dieser sollte über folgende Inhalte verfügen: XX Akustische Informationen (2) Auf Bahnsteigen müssen akustische Informationen zu abfahrenden Zügen (u. a. Zielbahnhof und wesentliche Zwischenhalte) rechtzeitig und auf verständliche Weise vor der Zugabfahrt gegeben werden. (3) Über Zugdurchfahrten ist ausnahmslos akustisch zu informieren. (4) Alle Abschnitte eines Bahnsteiges sind gleichmäßig und in verständlicher Weise zu beschallen. (5) Akustische Informationen zu betrieblichen Störungen (wie Zugverspätungen und Gleisänderungen) sind auf Bahnsteigen und in allen öffentlich zugänglichen Wegeverbindungen des Bahnhofs, einschließlich der hindernisfreien Wege, zur Verfügung zu stellen. (6) Bei Zügen mit Zugflügelung ist das Zugziel der jeweiligen Fahrzeuge akustisch zu benennen. (7) Informationen zur Zugbereitstellung müssen Angaben über Zugziel, wesentliche Halte und Abfahrtszeit verfügen. (8) Zugzielanzeigen auf Bahnsteigen müssen mit einem Taster zur individuellen Anforderung von akustischen Informationen für die analoge Wiedergabe der visuellen Anzeige verfügen. (9) Zugzielanzeigen auf Bahnsteigen sind zum Auffinden in das Blindenleitsystem einzubinden und sollten mit einem akustischen Orientierungssignal zur Auffindbarkeit ausgestattet sein. Visuelle Bodeninformationen „(1) Folgende öffentliche Bereiche der Infrastruktur müssen, soweit 👉🏻 Änderungsvorschlag: (1) Folgende öffentliche Bereiche der Infrastruktur müssen, soweit Die hier aufgezählten Zielorte sind durchgängig mit einem taktil und visuell gestalteten Blindenleitsystem zu verbinden, um deren Auffindbarkeit für blinde und sehbehinderte Menschen sicher zu ermöglichen. „(2) Die lichte Breite von hindernisfreien Wegen, Fußgängerüber- und -unterführungen muss mindestens 160 cm betragen, außer in den Bereichen gemäß den Abschnitten 4.2.1.2.2 (3a) (Rampen), 4.2.1.3 (2) (Türen), 4.2.1.12 (3) (Bahnsteige) und 4.2.1.15 (2) (schienengleiche Bahnübergänge).“ 👉🏻 Änderungsvorschlag: (2) Die lichte Breite von hindernisfreien Wegen, Fußgängerüber- und -unterführungen muss mindestens 180 cm betragen, außer in den Bereichen gemäß den Abschnitten 4.2.1.2.2 (3a) (Rampen), 4.2.1.3 (2) (Türen) und 4.2.1.12 (3) (Bahnsteige). Eine lichte Breite von mindestens 180 cm ist für einen Begegnungsfall zweier Rollstühle (bei einer vorzusehenden Spurbreite von 90 cm pro Rollstuhl) erforderlich. Ist diese nicht gegeben, so sind Begegnungen auf hindernisfreien Wegen, Fußgängerüber- und -unterführungen ausgeschlossen. Damit besteht in diesen Bereichen dann auch keine Barrierefreiheit. Die Ausnahme von „4.2.1.15 (2) (schienengleiche Bahnübergänge)“ sollte ersatzlos gestrichen werden, da auch hier für den Begegnungsfall eine Breite von mindestens 180 cm vorzusehen ist. „(2b) Zumindest vor der ersten Stufenkante einer Treppe nach unten 👉🏻 Änderungsvorschlag: (2b) Vor der ersten Stufenkante einer Treppe oder Einzelstufe nach unten sind taktile Bodenindikatoren anzubringen. Zur Auffindbarkeit für blinde und sehbehinderte Menschen sind vor der untersten ersten Setzstufe einer Treppe oder Einzelstufe taktile Bodenindikatoren vorzusehen. „(4) Treppen mit drei oder mehr Stufen und Rampen sind auf beiden Seiten und in zwei Höhen mit Handläufen auszustatten.“ 👉🏻 Ergänzungsvorschlag: (4) Treppen mit drei oder mehr Stufen und Rampen sind auf beiden Seiten und in zwei Höhen mit durchgängigen Handläufen auszustatten. Sie dürfen auf Zwischenpodesten nicht unterbrochen werden. Durchgängige Handläufe dienen dazu, eine sichere und barrierefreie Nutzung von Treppenanlagen zu gewährleisten. Die Hauptgründe sind: In diesem Zusammenhang dürfen Handläufe in vielen Ländern, aus sicherheitsrelevanten Gründen, nicht unterbrochen werden. Dieser Vorgabe sollte die TSI-PRM ebenfalls Rechnung tragen. 👉🏻 Ergänzungsvorschlag: (xx) Der Weg zu mindestens einer (jeweils geschlechtsspezifischen) Standard- und Universaltoilette ist durch taktile und visuell kontrastierende Bodenindikatoren zu kennzeichnen und in ein vorhandenes Blindenleitsystem einzubinden. Da blinde und sehbehinderte Reisende nicht zwangsweise auf die Nutzung von Universaltoiletten angewiesen sind und daher auch in der Praxis wahlweise Standardtoiletten nutzen, sollte hier diesem Aspekt Rechnung getragen werden. „(3) Zusätzlich oder als Alternative sind auch technische Lösungen zulässig, bei denen ferngesteuerte akustische Einrichtungen oder Telekommunikationsanwendungen eingesetzt werden. Lösungen 👉🏻 Ergänzungsvorschlag: (3) Zusätzlich oder als Alternative sind auch technische Lösungenzulässig, bei denen ferngesteuerte akustische Einrichtungen oder Telekommunikationsanwendungen eingesetzt werden. Lösungen dieser Art, die als Alternative verwendet werden sollen, sind als innovative Lösungen zu behandeln. Appbasierte Lösungen dürfen nur als ergänzende Angebote zu technischen Lösungen und nicht als alleinige Alternative zum Einsatz kommen. Die Palette, welche eine Nutzung des Smartphone verhindern, ist mannigfaltig. Insbesondere viele ältere und behinderte Menschen verfügen über kein Smartphone, da sie mit deren Handhabung und Bedienbarkeit überfordert sind. Zudem verhindern vielfältige Gründe, wie beispielsweise Störungen der Feinmotorik oder Sensibilität in den Fingern eine Nutzung des Smartphone. „(4) Sind entlang des hindernisfreien Weges zum Bahnsteig Handläufe oder Wände in Reichweite, so müssen Kurzinformationen (z. B. Nummer des Bahnsteigs oder Richtungsinformationen) angebracht sein. Diese Informationen müssen in Braille-Schrift oder in prismatischen Buchstaben bzw. Zahlen angebracht sein. Sie sind auf dem Handlauf oder an der Wand auf einer Höhe zwischen 145 cm und 165 cm anzubringen.“ 👉🏻 Änderungsvorschlag: (4) Sind entlang des hindernisfreien Weges zum Bahnsteig Handläufe oder Wände in Reichweite, so müssen Kurzinformationen (z. B. Nummer des Bahnsteigs oder Richtungsinformationen) angebracht sein. Diese Informationen müssen in Braille-Schrift oder in prismatischen Buchstaben bzw. Zahlen angebracht sein. Sie sind auf dem Handlauf oder an der Wand auf einer Höhe zwischen 130 cm und 160 cm anzubringen. Taktile Schriften sollten so angebracht werden, dass sie für Personen mit unterschiedlichen Körpergrößen gut erreichbar und für Rollstuhlnutzer gut lesbar sind. 👉🏻 Ergänzungsvorschlag: (3) Von Fußbodenoberflächen dürfen keine Spiegelungen und starken Lichtreflektionen hervorgerufen werden. „(1) Transparente Hindernisse in Form von Glastüren oder transparenten Wänden auf oder entlang den von Reisenden genutzten Wegen sind zu kennzeichnen. Die transparenten Hindernisse müssen durch diese Kennzeichnungen deutlich hervorgehoben werden. Eine Kennzeichnung ist nicht erforderlich, wenn die Reisenden durch andere Objekte vor einem Aufprall geschützt sind, beispielsweise durch Handläufe oder durchgehende Sitzbänke.“ 👉🏻 Ergänzungsvorschlag: (1) Transparente Hindernisse in Form von Glastüren oder transparenten Wänden auf oder entlang den von Reisenden genutzten Wegen sind zu kennzeichnen. Die transparenten Hindernisse müssen durch zwei Markierungsstreifen deutlich hervorgehoben werden. Von denen der obere Markierungsstreifen in einer Höhe zwischen 1.200 mm und 1.600 mm und der untere Markierungsstreifen in einer Höhe zwischen 400 mm und 700 mm anzubringen ist. Eine Kennzeichnung ist nicht erforderlich, wenn die Reisenden durch andere Objekte vor einem Aufprall geschützt sind, beispielsweise durch Handläufe oder durchgehende Sitzbänke. In der Regel richtet der gehende Mensch den Blick nach unten auf den Boden. Damit großwüchsige als auch kleinwüchsige Personen sowie Kinder und sehbehinderte Menschen die Sicherheitsmarkierung an transparenten Flächen im Blickfeld haben um das Hindernis rechtzeitig zu erkennen, ist die Anordnung von zwei Markierungsstreifen in unterschiedlichen Höhen zu empfehlen. Dabei sollte der obere Markierungsstreifen in einer Höhe zwischen 1.200 mm und 1.600 mm und der untere Markierungsstreifen in einer Höhe zwischen 400 mm und 700 mm angeordnet werden. 👉🏻 Ergänzung a): (xx) Zumindest ein barrierefrei gestalteter Fahrkarten-, Informations- und Kundenbetreuungsschalter muss, insofern vorhanden, in das im Bahnhof befindende Blindenleitsystem eingebunden werden. Das Blindenleitsystem reduziert das Risiko von Unfällen, indem es klare Wege und Orientierungspunkte aufzeigt. Ein nicht eingebundener Schalter ist für blinde und sehbehinderte Reisende schwer zu finden, was zu Unsicherheiten oder gar gefährlichen Situationen führen könnte. Die Einbindung der Fahrkarten-, Informations- und Kundenbetreuungsschalter in das Blindenleitsystem ermöglicht den Nutzern somit, die Schalter sicher und eigenständig aufzufinden. Durch die klare Integration der Schalter in das Leitsystem wird blinden und sehbehinderten Personen eine eigenständige Nutzung notwendiger Services wie Ticketkauf, Beratung oder andere Dienstleistungen ermöglicht. 👉🏻 Ergänzung b): (xx) Fahrkartenautomaten müssen über eine Sprachausgabe verfügen. Eine Ausstattung der Bedienelemente der Fahrkartenautomaten mit ertastbaren Braille-Zeichen ist zu begrüßen. Jedoch ist hier eine Ausstattung mit einer Sprachausgabe unverzichtbar. Die Displayanzeigen mit ihren wechselnden visuellen Informationen und Handlungsaufforderungen sind ohne eine Sprachausgabe für blinde und sehbehinderte Reisende nicht zugänglich, was, trotz der Ausstattung mit Braille-Zeichen, eine Nutzung verhindert. 👉🏻 Ergänzung c): (xx) Für die barrierefreie Nutzung der Fahrkartenautomaten sind diese entsprechend der DIN EN 301 549 „Barrierefreiheitsanforderungen für IKT-Produkte und -Dienstleistungen“ zu gestalten. Die Anwendung der DIN EN 301 549 ist essenziell, um die barrierefreie Nutzung von Fahrkartenautomaten für alle Menschen sicherzustellen, insbesondere für Personen mit Behinderungen (z. B. Sehbehinderungen, motorischen Einschränkungen oder kognitiven Beeinträchtigungen). Die Norm definiert Anforderungen an die Barrierefreiheit von Informations- und Kommunikationstechnologien, einschließlich Selbstbedienungsterminals wie Fahrkartenautomaten. 👉🏻 Ergänzungsvorschlag: (xx) Für alle öffentlich zugänglichen Verkehrsflächen, insbesondere für die hindernisfreien Wege, der Bahnhöfe ist eine gleichmäßige, schatten- und blendfreie Beleuchtung vorzusehen. „(4) Informationen über die Abfahrt von Zügen (u. a. Zielbahnhof, Zwischenhalte, Nummer des Bahnsteigs und Abfahrtszeit) müssen an mindestens einer Stelle im Bahnhof von einer Höhe von 👉🏻 Änderungsvorschlag: (4) Informationen über die Abfahrt von Zügen (u. a. Zielbahnhof, Zwischenhalte, Nummer des Bahnsteigs und Abfahrtszeit) müssen an mindestens einer Stelle im Bahnhof in einer Höhe bis zu maximal 160 cm (Oberkante) über dem Fußboden und hindernisfrei zugänglich angeordnet sein. Die im Zitat stehende Formulierung ist nicht nachvollziehbar und sorgt für Irritationen. Die Anordnungshöhe bis zu maximal 160 cm sowie die hindernisfreie Zugänglichkeit, ermöglicht sehbehinderten Menschen ein unmittelbares Herantreten und ggf. die Nutzung einer Sehhilfe (Lupe). Mit der hindernisfreien Zugänglichkeit von Informationen soll zum Ausdruck gebracht werden, dass diese nicht hinter Sitzbänken, Absperrungen usw. angebracht werden dürfen, um ein unmittelbares Herantreten zu ermöglichen. „(7) An folgenden Orten sind taktile Zeichen anzubringen: — Toiletten (wenn angemessen Funktionsinformationen und Hilferufinformationen) 👉🏻 Ergänzungsvorschlag: (7) An folgenden Orten sind taktile Zeichen anzubringen: — Toiletten (wenn angemessen Funktionsinformationen und Hilferufinformationen) Für alle Reisende gehören Informations- und Kundenbetreuungseinrichtungen sowie Reisezentren zu den wichtigsten Anlaufstellen, um für die Reise die erforderlichen Informationen zu erhalten. Für ältere Menschen und Personen mit Behinderungen sind sie die wichtigsten Anlaufpunkte auf dem Bahnhof, um sich die für die Reise benötigte Hilfe zu organisieren. Daher müssen diese Einrichtungen durch visuelle Informationen sicher und leicht erkennbar sein. In diesem Zusammenhang sollten sie auf dem Bahnhof auch so positioniert werden, dass eine mühevolle Suche erspart bleibt. „(14) Bei durchlaufenden Anzeigen (horizontal oder vertikal) muss jedes vollständige Wort mindestens zwei Sekunden lang angezeigt werden. Die horizontale Durchlaufgeschwindigkeit darf maximal sechs Zeichen pro Sekunde betragen.“ 👉🏻 Änderungsvorschlag: (14) Es sind vorzugsweise Wechselschriftanzeigen zu verwenden. Bei im Ausnahmefall zum Einsatz kommenden durchlaufenden Anzeigen (horizontal oder vertikal), muss jedes vollständige Wort mindestens drei Sekunden lang angezeigt werden. Die horizontale Durchlaufgeschwindigkeit darf maximal vier Zeichen pro Sekunde betragen. Laufschriften mit einer Anzeige von 2 Sekunden und einer Durchlaufgeschwindigkeit von max. 6 Zeichen pro Sekunde sind für viele Personengruppen, aufgrund der individuellen Lesegeschwindigkeit, nur sehr schwer lesbar. Daher sollte auf deren Einsatz verzichtet und Wechselschriftanzeigen bevorzugt werden. In diesem Zusammenhang sollte die Durchlaufgeschwindigkeit ebenfalls auf maximal vier Zeichen pro Sekunde beschränkt werden. Gestützt wird diese Forderung durch folgende fachlichen Aussagen: Bachelorarbeit „Erkennbarkeit von LED-Laufschriften im öffentlichen Bereich für Sehbehinderte“ von Tina Nachreiner an der Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena, Fachbereich SciTec, Studiengang Augenoptik/Optometrie „Die Daten von 20 Personen konnten ausgewertet werden. Als wichtigste Erkenntnis ergab sich, dass eine maximale Grenzgeschwindigkeit von 3,53 Zeichen pro Sekunde (Z/s) nicht überschritten werden sollte. Dies ist dabei unabhängig von der Schriftgröße (bei Anpassung der Entfernung). Als weiteres Ergebnis ergab sich, dass sich die verwendete Schrift „mittel“ am besten eignete. Diese Schrift hat ein Größenverhältnis von Zeichenhöhe zu -breite von 1,26:1 (59,9 mm zu 47,7 mm). Die neu gewonnenen Erkenntnisse sollten unbedingt im öffentlichen Bereich berücksichtigt werden, denn nicht nur Sehbehinderte können davon profitieren. Bereits bestehende Anzeigen mit Laufschriften sollten angepasst werden, denn die in der Literatur angegebene Maximale Durchlaufgeschwindigkeit von 6 Z/s ist zu schnell.“ „Bericht über die Lesbarkeit optisch-dynamischer Fahrgastanzeigen“ von Fritz Buser „6.8 Blindende und laufende Anzeigen […]
Jedes Segment einer wechselnden Anzeige soll pro 30 Zeichen 5 Sekunden angehalten werden. „(1) Das Bahnsteigende ist entweder durch eine Absperrung gegen öffentlichen Zutritt abzugrenzen oder durch eine visuelle Markierung und taktile Bodenindikatoren mit einem Aufmerksamkeitsfeld 👉🏻 Änderungsvorschlag: (1) Das Bahnsteigende ohne öffentlichen Zugang ist durch eine Absperrung (Geländer) gegen öffentlichen Zutritt abzugrenzen oder durch eine visuelle Markierung und taktile Bodenindikatoren mit einem Aufmerksamkeitsfeld zu kennzeichnen. Um sicher zu gehen, dass ein Bahnsteigende ohne öffentlichen Zugang, trotz Kennzeichnung mit Bodenindikatoren, von blinden oder sehbehinderten Personen nicht verfehlt wird, sollte vorsorglich eine zusätzliche Absperrung (Geländer) erfolgen. Zudem kann diese Absperrung auch für andere unaufmerksame Personen von sicherheitsrelevanter Bedeutung sein. „(2) […]
„— sind vor schienengleichen Bahnübergängen Umlaufsperren aufgestellt, um unbeabsichtigtes oder unkontrolliertes Überqueren der Gleise zu verhindern, so darf die Mindestbreite auf dem Übergang und in der Umlaufsperre weniger als 120 cm, aber nicht weniger als 90 cm betragen; Rollstuhlfahrer 👉🏻 Änderungsvorschlag: (2) […] Für das Manövrieren bzw. der Vornahme einer Richtungsänderung für Rollstuhlnutzer bedarf es einer Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm. Daher ist eine Mindestbreite von 120 cm in der Umlaufsperre nicht ausreichend. Auf dem Übergang sollte aus sicherheitsrelevanten Gründen für alle Reisenden eine zügige Räumungsmöglichkeit, insbesondere auch für mobilitätsbeeinträchtigte Personen (Rollstuhl- und Rollatornutzer) sichergestellt werden. Dies schließt einen möglicherweise entstehenden Begegnungsfall ein. Eine Beschränkung der Breite auf 120 cm kann sich in kritischen Situationen als Hindernis herausstellen. Daher ist für den Übergang eine Breite von 180 cm (Breite für zwei sich begegnende Rollstuhlnutzer) dringend zu empfehlen. „— bewacht sein; andernfalls müssen unter Beachtung der nationalen Vorschriften Ausrüstungen vorhanden sein, die blinden oder sehbehinderten Menschen das sichere Überqueren ermöglichen, und/oder die niveaugleichen Überquerungen müssen so betrieben werden, dass sie von sehbehinderten Menschen sicher überquert werden können.“ 👉🏻 Änderungsvorschlag: — bewacht sein; andernfalls müssen unter Beachtung der nationalen Vorschriften Ausrüstungen vorhanden sein, die blinden und sehbehinderten Menschen das sichere Auffinden ermöglichen. Die niveaugleichen Überquerungen müssen mit Hilfe von visuellen und akustischen Freigabeanzeigen der Querung so betrieben werden, dass sie von Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen (gehörlosen, schwerhörigen, blinden und sehbehinderten Menschen) sicher überquert werden können. Aus der Praxis sind Faktoren bekannt, die die Wahrnehmung von ein- oder durchfahrenden Zügen zusätzlich erschweren und daher berücksichtigt werden müssen. Zu diesen sind zu zählen: Tandembeförderung 👉🏻 Ergänzungsvorschlag a): In dieses Kapitel sollte neu aufgenommen werden: (xx) Mindestens jeder zweite Vorrangsitz ist mit einer Steckdose / USB-Anschluss auszurüsten. Dank der raschen Weiterentwicklung auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung ist ebenfalls ein deutlicher Zuwachs elektronischer Hilfsmittel zu verzeichnen. Der zunehmende Einsatz von elektronischen Hilfsmitteln für die Information und Kommunikation ist insbesondere für Menschen mit Behinderung auf Reisen oftmals von unentbehrlicher Bedeutung. 👉🏻 Ergänzungsvorschlag b): In dieses Kapitel sollte neu aufgenommen werden: (xx) Jeder Vorrangsitz ist mit einer dimmbaren Leseleuchte auszustatten, die den erhöhten Beleuchtungsbedarf sehbehinderter Menschen berücksichtigt. Zur Verbesserung der visuellen Wahrnehmung von schriftlichen Fahrgastinformationen, zum Lesen und Bearbeiten von Schriftgut, sind individuell einstellbare Leseleuchten erforderlich, die den Bedürfnissen von Menschen mit den unterschiedlichsten Sehbehinderungen entsprechen und genutzt werden können. 👉🏻 Ergänzungsvorschlag c): In dieses Kapitel sollte neu aufgenommen werden: (xx) Alle Vorrangsitze sind mit einer Hilferufeinrichtung (entsprechend DIN EN 16683 Bahnanwendungen – Hilferufvorrichtungen und Kommunikationseinrichtungen für Fahrgäste – Anforderungen) auszustatten. Deren Tasten müssen eindeutig visuell und taktil erkennbar sein. Ihre Betätigung darf nicht durch eine Anordnung in Vertiefungen oder durch Abdeckungen beeinträchtigt werden. Allein reisende Menschen mit Handicap benötigen in vielen unvorhersehbaren Situationen, wie z. B. bei außerplanmäßiger Zugendigung, Verspätung etc., eine Assistenz. In derartigen Situationen muss die Möglichkeit zur Anmeldung eines Hilfebedarfs beim zuständigen Zugpersonal gegeben sein. Die Betroffenen dürfen sich nicht selbst überlassen bleiben! „(6) Bestehen mehr als 75 % der Türoberfläche aus einem transparenten Werkstoff, so ist die Tür durch deutlich sichtbare Markierungen zu kennzeichnen.“ 👉🏻 Änderungsvorschlag: (6) Bestehen mehr als 75 % der Türoberfläche aus einem transparenten Werkstoff, so ist die Tür durch zwei deutlich sichtbare Markierungsstreifen zu kennzeichnen. Von denen der obere Markierungsstreifen in einer Höhe zwischen 1.200 mm und 1.600 mm und der untere Markierungsstreifen in einer Höhe zwischen 400 mm und 700 mm anzubringen ist. In der Regel richtet der gehende Mensch den Blick nach unten auf den Boden. Damit großwüchsige als auch kleinwüchsige Personen sowie Kinder und sehbehinderte Menschen die Sicherheitsmarkierung an transparenten Flächen im Blickfeld haben um das Hindernis rechtzeitig zu erkennen, ist die Anordnung von zwei Markierungsstreifen in unterschiedlichen Höhen zu empfehlen. Dabei sollte der obere Markierungsstreifen in einer Höhe zwischen 1.200 mm und 1.600 mm und der untere Markierungsstreifen in einer Höhe zwischen 400 mm und 700 mm angeordnet werden. 👉🏻 Ergänzungsvorschlag: In diesen Abschnitt sollte eingefügt werden: 👉🏻 Ergänzungsvorschlag a): (xx) Alle Lautsprecheranlagen in den Zügen müssen für jeden einzelnen Fahrzeugtrakt eine separate akustische Kundeninformation ermöglichen. Bei der Trennung von Zügen (Zugflügelung) muss eine separate akustische Kundeninformation, insbesondere zum Zugziel, jedes einzelnen Fahrzeuges des Zugverbandes möglich sein. 👉🏻 Ergänzungsvorschlag b): (xx) Es sind akustische Kundeninformationen zum Zugziel, einschließlich Angaben über Verspätungen und unplanmäßiger Halte, bereitzustellen. Bei der Trennung von Zügen mit unterschiedlichen Fahrzielen fehlt vielen Personengruppen, wie beispielsweise blinden und sehbehinderten Reisenden, eine verlässliche Kenntnis über das Ziel des Fahrzeugtraktes, in welchem sie sich befinden. Eine akustische Kundeninformation, wie z. B.: „Bitte beachten Sie die Zugzielanzeige über der Tür“, ist weder hilfreich noch angemessen. Blinden und sehbehinderten Menschen, Analphabeten usw. haben zu der unverzichtbaren Information zum Zugziel keinen Zugang. Dies muss durch eine rechtzeitige akustische Benennung des Zugziels vor der Zugtrennung kompensiert werden. „(8) Taktile Zeichen sind anzubringen in: — Fahrzeugen für Vorrichtungen zum Öffnen/Schließen von für Reisende zugänglichen Türen und Hilferufvorrichtungen.“ 👉🏻 Ergänzungsvorschlag: (8) Taktile Zeichen sind anzubringen in: — Fahrzeugen für Vorrichtungen zum Öffnen/Schließen von für — Zur Kennzeichnung von Sitzplätzen, insbesondere bei Es ist zu gewährleisten, dass blinde und sehbehinderte Reisende selbständig und ohne fremde Hilfe ihren (reservierten) Sitzplatz auffinden können. „(1) Der Zielbahnhof oder der Zuglauf ist außen am Zug auf Bahnsteigseite neben mindestens einer der Einstiegstüren für Reisende an mindestens jedem zweiten Fahrzeug des Zuges anzuzeigen.“ 👉🏻 Änderungsvorschlag: (1) Der Zielbahnhof oder der Zuglauf ist außen am Zug auf Bahnsteigseite, neben mindestens einer der Einstiegstüren, für Reisende an jedem Fahrzeug des Zuges anzuzeigen. „(2) Verkehren die Züge in einem System, in dem auf den Bahnsteigenin Abständen von maximal 50 m dynamische visuelle Informationen angezeigt werden, und sind außerdem Informationen über den Zielbahnhof oder den Zuglauf an der Zugspitzevorhanden, so müssen an den Fahrzeugseiten keine Informationen angezeigt werden.“ 👉🏻 Änderungsvorschlag: Dieser Abschnitt ist ersatzlos zu streichen. Die in Absatz (1) aus der Sicht sehbehinderter Reisender erforderlichen Anforderungen werden durch Absatz (2) deutlich eingeschränkt. Dynamische visuelle Informationen müssen in Unabhängigkeit, einer Anordnung in Abständen von 50 m auf Bahnsteigen sowie an der Zugspitze, ebenfalls außen am Zug auf der Bahnsteigseite neben den Einstiegstüren vorgesehen werden. Es gelten die Begründungen zu 4.2.2.7.4. „(11) Bei durchlaufenden Anzeigen (horizontal oder vertikal) mussjedes vollständige Wort mindestens zwei Sekunden lang angezeigt werden. Die horizontale Durchlaufgeschwindigkeit darf im Durchschnitt maximal sechs Zeichen pro Sekunde betragen.“ 👉🏻 Änderungsvorschlag: (11) Bei durchlaufenden Anzeigen (horizontal oder vertikal) muss jedes vollständige Wort mindestens drei Sekunden lang angezeigt werden. Die horizontale Durchlaufgeschwindigkeit darf im Durchschnitt maximal vier Zeichen pro Sekunde betragen. Für sehbehinderte Menschen sowie für einen großen Personenkreis mit reduzierter Sprach- und Lesekompetenz, ist Laufschrift grundsätzlich problematisch. Oftmals besteht eine sehr individuelle Lesegeschwindigkeit, sodass bei einer zu schnellen Laufschrift, keine ausreichende Möglichkeit zur Wahrnehmung visueller Informationen besteht (vgl. auch die Begründung zu 4.2.1.10. Visuelle Informationen: Wegweiser, Piktogramme, gedruckte oder dynamische Informationen (14). 👉🏻 Ergänzungsvorschlag a): (xx) Alle Lautsprecheranlagen in den Zügen müssen für jeden einzelnen Fahrzeugtrakt eine separate akustische Kundeninformation ermöglichen. Bei der Trennung von Zügen (Zugflügelung) muss eine separate akustische Kundeninformation, insbesondere zum Zugziel, jedes einzelnen Fahrzeuges des Zugverbandes möglich sein. 👉🏻 Ergänzungsvorschlag b): (xx) Es sind akustische Kundeninformationen zum Zugziel, einschließlich Angaben über Verspätungen und unplanmäßige Halte, bereitzustellen. Bei der Trennung von Zügen mit unterschiedlichen Fahrzielen fehlt vielen Personengruppen, wie beispielsweise blinden und sehbehinderten Reisenden, eine verlässliche Kenntnis über das Ziel des Fahrzeugtraktes, in welchem sie sich befinden. Eine akustische Kundeninformation, wie z. B.: „Bitte beachten Sie die Zugzielanzeige über der Tür“, ist weder hilfreich noch angemessen. Blinden und sehbehinderten Menschen, Analphabeten usw. haben zu der unverzichtbaren Information zum Zugziel keinen Zugang. Dies muss durch eine rechtzeitige akustische Benennung des Zugziels vor der Zugtrennung kompensiert werden. „(2) Mindestens die erste und die letzte Stufe sind durch ein kontrastierendes Band zu kennzeichnen, das sich über die gesamte Breite der Stufen erstrecken muss und an der Vorderseite und der Oberseite der Stufenkante anzubringen ist, und folgende Tiefe besitzt: — 45 mm bis 55 mm an der Vorderseite, — 45 mm bis 75 mm an der Oberseite.“ 👉🏻 Änderungsvorschlag: (2) Aus Sicherheitsgründen sind alle Stufen durch ein kontrastierendes Band zu kennzeichnen, das sich über die gesamte Breite der Stufen erstrecken muss und an der Vorderseite und der Oberseite der Stufenkante anzubringen ist, und folgende Tiefe besitzt: — 45 mm bis 55 mm an der Vorderseite, — 45 mm bis 75 mm an der Oberseite. Diese Bänder müssen im Kontrast sowohl zum Stufenbelag, als auch zu den anschließenden Podesten stehen. „(4) Außentüren sind mit Haltestangen auf beiden Seiten der Türöffnung auszustatten, die im Innern so dicht wie möglich an die Außenwand des Fahrzeugs reichen müssen. Ausnahmen auf einer Seite der Türöffnung sind zulässig, wenn auf dieser Seite eine Vorrichtung wie ein fahrzeugseitiger Hublift installiert ist.“ 👉🏻 Änderungsvorschlag: (4) Außentüren sind mit Haltestangen auf beiden Seiten der Türöffnung auszustatten, die im Innern im Abstand von max. 200 mm von der Außenwand des Fahrzeugs entfernt sein dürfen. Ausnahmen auf einer Seite der Türöffnung sind zulässig, wenn auf dieser Seite eine Vorrichtung wie ein fahrzeugseitiger Hublift installiert ist. Die Haltestangen müssen uneingeschränkt zur Sicherheit für alle Personengruppen vom Bahnsteig aus gut erreichbar sein. Unbekannte Spaltbreiten, Stufengestaltungen und Höhendifferenzen sind nur sicher zu überwinden, wenn die Hand einen festen Halt findet. „(5) Für Haltestangen nach Absatz 4 gelten folgende Anforderungen: — Bei allen Außentüren müssen sich vertikale Haltestangenüber einen Bereich zwischen 700 mm und 1200 mm über der Schwelleder ersten Stufe erstrecken.[…]“ 👉🏻 Änderungsvorschlag: (5) Für Haltestangen nach Absatz 4 gelten folgende Anforderungen: — Bei allen Außentüren müssen sich vertikale Haltestangen über einenBereich zwischen 400 mm und 1200 mm über der Schwelle der ersten Stufe erstrecken. […] Die Erreichbarkeit dürfte für Kinder sowie kleinwüchsige Menschen (Mikrosomie) zu hoch angesetzt sein. Für eine sichere Erreichbarkeit der vertikalen Haltestange, ist eine Anordnungshöhe zwischen 400 m und 1200 mm über der Schwelle der ersten Stufe zu empfehlen. Anmerkung 1 „— Unbesetzte Bahnhöfe — Fahrkartenverkauf für sehbehinderte Reisende Für unbesetzte Bahnhöfe, auf denen ausschließlich Fahrkartenverkaufsautomaten zur Verfügung stehen (siehe Abschnitt 4.2.1.8), müssen schriftliche betriebliche Regelungen festgelegt und umgesetzt werden. Für sehbehinderte Reisende muss in diesen Fällen jederzeit eine alternative Möglichkeit zum Fahrkartenkauf bestehen (z. B. im Zug oder am Zielbahnhof).“ 👉🏻 Änderungsvorschlag: — Unbesetzte Bahnhöfe — Fahrkartenverkauf für Reisende Für unbesetzte Bahnhöfe, auf denen ausschließlich Fahrkartenverkaufsautomaten zur Verfügung stehen (siehe Abschnitt 4..2.1.8), müssen schriftliche betriebliche Regelungen festgelegt und umgesetzt werden. Für Reisende muss in diesen Fällen jederzeit eine alternative Möglichkeit zum Fahrkartenkauf bestehen (z. B. im Zug oder am Zielbahnhof). Ein digitaler Fahrkartenverkauf als einzige und alleinige Alternative zum analogen Fahrkartenverkauf ist nicht zulässig. Da nicht nur sehbehinderte Reisende, sondern auch viele ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen oftmals Schwierigkeiten bei der Bedienbarkeit von Fahrkartenautomaten haben, muss auch für sie, sowie für alle Reisenden, jederzeit eine alternative Möglichkeit zum Fahrkartenkauf bestehen. Bezüglich der digitalen Alternativen gelten die Anmerkungen zu den „Den Digitalen Leistungen und Kundenservices in den Bereichen der Teilsysteme „Infrastruktur“ und „Fahrzeuge“. Anmerkung 2 „— Hilfeleistung beim Ein- und Aussteigen Es sind betriebliche Regelungen umzusetzen, die gewährleisten, dass das Personal sich darüber im Klaren ist, dass Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität 👉🏻 Änderungsvorschlag: — Hilfeleistung beim Ein- Aus- und Umsteigen Es sind betriebliche Regelungen umzusetzen, die gewährleisten, dass das Personal sich darüber im Klaren ist, dass Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität möglicherweise Hilfe beim Ein-, Aus- und Umsteigen benötigen. Außerdem müssen diese Regelungen gewährleisten, dass das Personal bei Bedarf diese Hilfe leistet. Dies gilt auch verpflichtend für einen planmäßig erfolgenden und spontan entstandenen Schienenersatzverkehr. „Es sind genaue Informationen über den Zuglauf oder das Netz, in dem der Zug verkehrt, bereitzustellen (über die Art der Bereitstellung dieser Informationen entscheidet das Eisenbahnunternehmen).“ 👉🏻 Änderungsvorschlag: Es sind genaue visuelle und akustische Informationen über den Zuglauf oder das Netz, in dem der Zug verkehrt, bereitzustellen. Die Entscheidung über die Art der Informationsbereitstellung darf dem Eisenbahnunternehmen nicht überlassen werden. Dies führt in der Praxis dazu, dass diese wesentlichen Informationen nicht im Zwei-Sinne-Prinzip angeboten werden. Die Praxis zeigt, dass dann vornehmlich nur visuelle Informationen zum Zuglauf gegeben werden. Ein eingeschränkter akustischer Hinweis, wie beispielsweise „Bitte beachten Sie die Zugzielanzeige über der Tür“, ist nicht hilfreich. In der Folge erhalten beispielsweise blinde oder sehbehinderte Reisende keinen Zugang zu den genauen Informationen über den Zuglauf. „Es sind betriebliche Regelungen umzusetzen, die gewährleisten, dass das Personal sich darüber im Klaren ist, dass Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität möglicherweise Hilfe beim Ein- und Aussteigen benötigen. Außerdem müssen diese Regelungen gewährleisten, dass das Personal bei Bedarf diese Hilfe leistet.“ 👉🏻 Ergänzungsvorschlag: Es sind betriebliche Regelungen umzusetzen, die gewährleisten, dass das Personal sich darüber im Klaren ist, dass Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität möglicherweise Hilfe beim Ein- und Aussteigen benötigen. Außerdem müssen diese Regelungen gewährleisten, dass das Personal bei Bedarf diese Hilfe leistet. Dies gilt auch verpflichtend für einen planmäßig erfolgenden und spontan entstandenen Schienenersatzverkehr. 👉🏻 Ergänzungsvorschlag: (3) Die Türbedienelemente müssen zu ihrem Hintergrund selbst im visuellen Kontrast stehen. Eine visuell kontrastreiche Gestaltung der Türbedienelemente ist erforderlich, um letztlich nicht nur sehbehinderten Menschen eine rechtzeitige Orientierung zu ermöglichen und deren Auffindbarkeit für alle Reisenden zu erleichtern. 👉🏻 Ergänzungsvorschlag: (xx) Ein Bedienelement zur Betätigung der Spülvorrichtung muss oberhalb des hochgeklappten WC-Deckels angeordnet sein. Diese einheitliche Positionierung des Bedienelementes für die WC-Spüleinrichtung erleichtert, auch aus hygienischen Gründen, blinden und sehbehinderten Menschen die Auffindbarkeit und erspart ein mühevolles Suchen. „(2) Wenn eine Tür verriegelt wurde, ist dies innerhalb und außerhalb der Toilette visuell und taktil (oder akustisch) kenntlich zu machen.“ 👉🏻 Änderungsvorschlag: (2) Wenn eine Tür verriegelt wurde, ist dies innerhalb und außerhalb der Toilette visuell und taktil (oder akustisch) kenntlich zu machen. Dabei muss auf der Türaußenseite der Toilette die Türverriegelung den jeweiligen Status „frei“, „besetzt“ oder „defekt“ anzeigen. Die Information über den jeweiligen Toilettenstatus ist für blinde und sehbehinderte Menschen wichtig und muss für sie auch zugänglich sein. So können sie sich auf die entsprechende Situation einstellen und es bleibt ihnen, ggf. bei defekten Toiletten, ein unangenehmes Warten erspart, bis die Toilette frei wird. © Mobilfuchs, 06.01.2024
vom 18. November 2014 über die technischen Spezifikationen für die Interoperabilität bezüglich der Zugänglichkeit des Eisenbahnsystems der Union für Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität.zu 2.1. Anwendungsbereich der Teilsysteme
massive Barrieren bestehen, darf dieser nicht für eine durchgehende und ununterbrochene Reisekette völlig außer acht bleiben. zu 2.2. Bestimmung des Begriffs „Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität“
zu 2.3. Sonstige Begriffsbestimmungen
„Taktile Zeichen“ und „taktile Bedienelemente“ sind Zeichen oder Bedienelemente, welche erhabene Piktogramme, erhabene Schriftzeichen oder Braille-Beschriftungen beinhalten.“
Taktile Zeichen“ und „taktile Bedienelemente“ sind Zeichen oder Bedienelemente, welche erhabene Piktogramme, erhabene Schriftzeichen oder Braille-Beschriftungen beinhalten. Piktogramme dürfen nur in Verbindung mit Brailleschrift und Profilschrift [raised lettering / prismatic] eingesetzt werden.zu 4.2.1. Teilsystem „Infrastruktur“
Dies führt oftmals nicht nur zur Unsicherheit für die Betroffenen, sondern es wird ihnen dadurch der Zugang zum Eisenbahnsystem zumindest erschwert, wenn nicht sogar gänzlich verwehrt.
— Sicherheitsinformationen und Sicherheitsanweisungen
— Warn- und Verbotsinformationen
— Informationen über betriebliche Störungen
— Informationen zu ein- und ausfahrenden Zügen
— Informationen zu Zugbereitstellungen
zu 4.2.1.2. Hindernisfreie Wege (1)
vorhanden, über hindernisfreie Wege miteinander verbunden sein:“
vorhanden, über hindernisfreie Wege durch ein taktil und visuell gestaltetes Blindenleitsystem miteinander verbunden sein:zu 4.2.1.2. Hindernisfreie Wege (2)
zu 4.2.1.2.2. Vertikale Erschließung (2b)
mit drei oder mehr Stufen sind taktile Bodenindikatoren anzubringen.“
Die taktile Leitlinie „Wand“ setzt sich über die bündig angeordnete Setzstufe fort und bietet keine taktilen Hinweise für den Blindenlangstock auf das Vorhandensein einer Treppe.
Daher ist es unverzichtbar, auch vor der untersten Setzstufe einer Treppe, auf diese mit taktilen Bodenindikatoren hinzuweisen.zu 4.2.1.2.2. Vertikale Erschließung (4)
zu 4.2.1.2.3. Kennzeichnung der Wege
zu 4.2.1.2.3. Kennzeichnung der Wege (3)
dieser Art, die als Alternative verwendet werden sollen, sind als innovative Lösungen zu behandeln.“
Kommen nur digitale Lösungen zum Einsatz, werden die Betroffenen von der Nutzung von Angeboten ausgeschlossen. Dies führt folglich zu einer ungerechtfertigten Benachteiligung und Diskriminierung.zu 4.2.1.2.3. Kennzeichnung der Wege (4)
Um aus lesetechnischen Gründen eine optimale Lesbarkeit mit der Hand zu gewährleisten, sollte die Anordnungshöhe an einer vertikalen Wand zwischen 130 cm bis 160 cm über dem Boden liegen. Diese Höhe ermöglicht eine bequeme Nutzung für die meisten Menschen. Taktile Informationen an einer Wand in einer Höhe von 165 cm zu finden und zu lesen ist kaum möglich.zu 4.2.1.4. Fußbodenoberflächen
zu 4.2.1.5. Kennzeichnung transparenter Hindernisse
zu 4.2.1.8. Fahrkartenschalter, Informations- und Kundenbetreuungsschalter
zu 4.2.1.9. Beleuchtung
Die daraus resultierende Verzögerung der Adaptationsfähigkeit erlaubt es nicht, Hindernisse und Gefahren rechtzeitig wahrzunehmen. Daher empfiehlt es sich auch nicht, Punktstrahler als einzige Bahnhofsbeleuchtung zu verwenden.zu 4.2.1.10. Visuelle Informationen: Wegweiser, Piktogramme, gedruckte oder dynamische Informationen (4)
160 cm aus lesbar angebracht sein.“ zu 4.2.1.10. Visuelle Informationen: Wegweiser, Piktogramme, gedruckte oder dynamische Informationen (7)
— Aufzüge gemäß der in Anlage A Index 1 genannten Spezifikation.“
— Aufzüge gemäß der in Anlage A Index 1 genannten Spezifikation
— Informations- und Kundenbetreuungseinrichtungen, Reisezentrenzu 4.2.1.10. Visuelle Informationen: Wegweiser, Piktogramme, gedruckte oder dynamische Informationen (14)
Laufschriften sind für sehbehinderte Personen kaum lesbar und deshalb zu
vermeiden.“ zu 4.2.1.13. Bahnsteigende (1)
zu kennzeichnen.“ zu 4.2.1.15. Schienengleiche Bahnübergänge in Bahnhöfen (2)
müssen ungehindert manövrieren können.“
„— sind vor schienengleichen Bahnübergängen Umlaufsperren
aufgestellt, um unbeabsichtigtes oder unkontrolliertes Überqueren
der Gleise zu verhindern, so soll die Breite der Wege in der Umlaufsperre 150 cm und auf dem Übergang 180 cm betragen; Rollstuhlfahrer müssen ungehindert manövrieren können.“zu 4.2.1.15. Schienengleiche Bahnübergänge in Bahnhöfen (3)
zu 4.2.2. Teilsystem „Fahrzeuge“
zu 4.2.2.1.2.1. Allgemeines
zu 4.2.2.3.3. Innentüren (6)
zu 4.2.2.4. Beleuchtung
Die daraus resultierende Verzögerung der Adaptationsfähigkeit erlaubt es nicht Hindernisse und Gefahren rechtzeitig wahrzunehmen, die sich in dunklen und nicht ausreichend beleuchteten Bereichen befinden. Daher empfiehlt es sich auch nicht, Punktstrahler als einzige Beleuchtung zu verwenden.zu 4.2.2.7.4. Dynamische akustische Informationen
zu 4.2.2.7.2. Zeichen, Piktogramme und taktile Informationen (8)
— Toiletten und rollstuhlgerechten Schlafgelegenheiten, gegebenenfalls Funktionsinformationen und Hilferufvorrichtung,
— Toiletten und rollstuhlgerechten Schlafgelegenheiten, gegebenenfalls
Funktionsinformationen und Hilferufvorrichtung,
Reisende zugänglichen Türen und Hilferufvorrichtungen.
vorhandenen Reservierungssystemen, sind taktile Zeichen
(Buchstaben und Ziffern) in Braille- und erhabener Profilschrift
vorzusehen.zu 4.2.2.7.3. Dynamische visuelle Informationen (1)
Bei längeren Zügen oder unter verschiedenen Bahnsteigbedingungen kann sich diese Schwierigkeit zusätzlich verschärfen. Gleiches gilt ebenfalls durch Züge mit Zugteilung, wo es zwingend notwendig ist den richtigen Zugteil zu finden.zu 4.2.2.7.3. Dynamische visuelle Informationen (2)
zu 4.2.2.7.3. Dynamische visuelle Informationen (11)
zu 4.2.2.7.4. Dynamische akustische Informationen
zu 4.2.2.8. Niveauwechsel (2)
zu 4.2.2.9. Haltestangen (4)
zu 4.2.2.9. Haltestangen (5)
zu 4.4. Betriebliche Regelungen
zu 4.4.1. Teilsystem „Infrastruktur“
möglicherweise Hilfe beim Ein- und Aussteigen benötigen. Außerdemmüssen diese Regelungen gewährleisten, dass das Personal bei Bedarf diese Hilfe leistet.“
zu 4.4.2.10. Visuelle und akustische Informationen — Werbebeschränkung
zu 4.4.2.15. Hilfeleistung beim Ein- und Aussteigen
Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf spontan entstandene Schienenersatzverkehre (infolge betrieblicher Störungen) zu richten.zu 5.3.2.1. Bedienelemente von Türen
zu 5.3.2.2. Standard- und Universaltoiletten: Gemeinsame Parameter
zu 5.3.2.2. Standard- und Universaltoiletten: Gemeinsame Parameter (2)
Als Dankeschön für Ihre Registrierung erhalten Sie kostenlos die wertvolle Liste „Checkliste zur Sturzprohylaxe“.